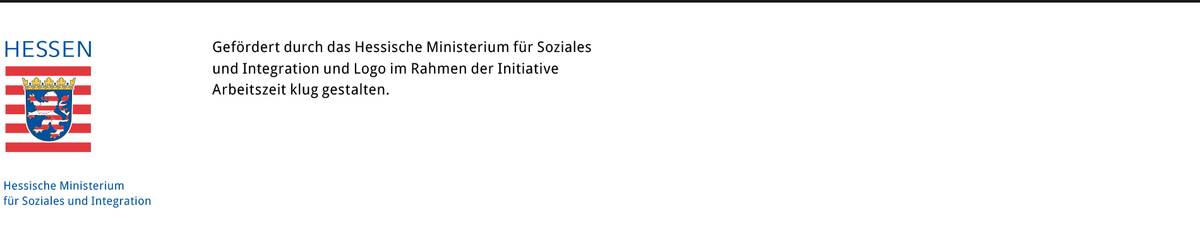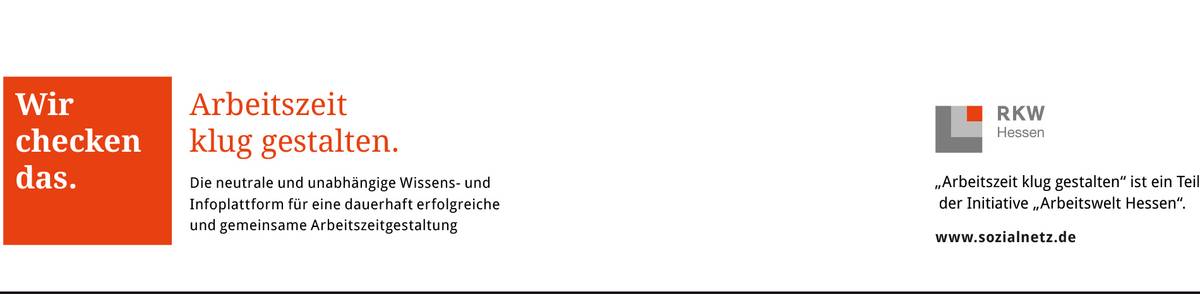
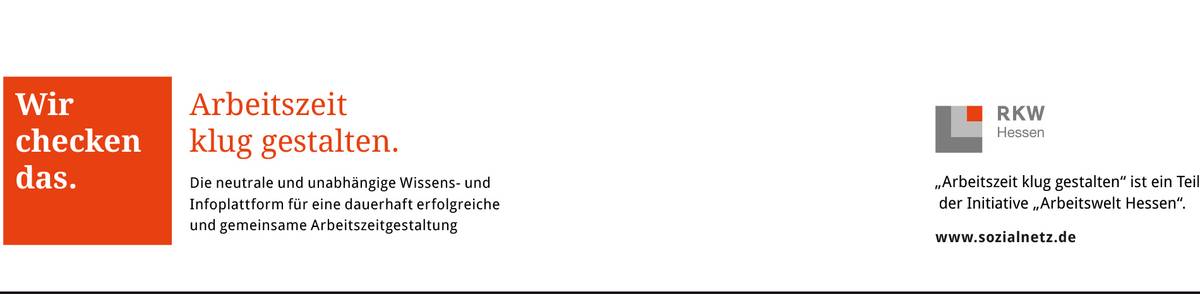
Das RKW Hessen berät mit seinem Netzwerk bundesweit zu guter Arbeitszeitgestaltung. Zwei Möglichkeiten stehen Ihnen offen:
Eine kompakte Analyse der Ist-Situation sowie konkrete Hinweise, wo Ihre Stärken und Schwächen in der Arbeitszeit-Gestaltung liegen und wie Sie Ihr gegenwärtiges Modell weiterentwickeln können.
Erfahrene Arbeitszeitberater unterstützen Sie bei der Entwicklung des neuen Arbeitszeitmodells, von der Zielformulierung bis zum Abschluss der Testphase.
Eine gute Arbeitszeitberatung entwickelt ein für das Unternehmen maßgeschneidertes Arbeitszeitmodell. Auf der Basis der klar definierten Zielvorgaben werden gemeinsam von Unternehmensleitung, Betriebsrat/Beschäftigten und Berater Alternativen entwickelt. Die Beraterin/der Berater unterstützt die Beteiligten dabei, die Alternativen unter den Aspekten Arbeitsrecht, Wirtschaftlichkeit, Beschäftigtenorientierung und Gesundheitsschutz einzuordnen und damit eine gute Entscheidung zu ermöglichen. Branchenerfahrung und Kompetenz in der Arbeitszeitgestaltung sind dabei von großer Bedeutung. Schließlich achtet der Berater darauf, dass die schriftliche Vereinbarung alle wichtigen zu regelnden Aspekte umfasst (z.B. Vorlaufzeiten von Dienstplänen, Regelungen bei Kündigungen, Erkrankung, Urlaub, Schlichtung in Streitfällen etc.). Eine Checkliste finden Sie hier.
Kleinen und mittleren Unternehmen stehen derzeit folgende Förderoptionen offen:
Bundesweite Förderung von Beratung zu Arbeitsorganisation, Führung, Personal für kleine und mittlere Unternehmen, Fördermittelgeber ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Der Fördermittelbetrag liegt bei maximal 5.000 EUR. Das RKW Hessen ist als Berater zur Arbeitszeitgestaltung autorisiert.
Bundesweite Förderung zu betriebswirtschaftlichen Fragestellungen für kleine und mittlere Unternehmen, Fördermittelgeber ist das Bundesministerium für Wirtschaft. Der Fördermittelbetrag liegt bei maximal 1.500 EUR. Das RKW Hessen ist als Berater zur Arbeitszeitgestaltung autorisiert.
Das RKW Hessen betreut die Fördermittelvergabe des Landes Hessen an kleine und mittlere Unternehmen in Hessen. Auch eine vertiefende Beratung zur Arbeitszeitgestaltung kann gefördert werden, sofern im Vorfeld eine Bundesförderung zum selben Thema erfolgt ist. Wir beraten Sie gerne telefonisch.
Auch einige Berufsgenossenschaften bieten Unterstützung, beispielsweise bei der Schichtplangestaltung. Fragen Sie am besten bei Ihrer BG nach.
Eine tarifrechtliche Beratung bieten die jeweiligen Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften.
Eine Rechtsberatung erhalten Sie von Rechtsanwälten, die sich auf Arbeits(zeit)recht spezialisiert haben.
Handwerksbetriebe können sich für eine qualifizierte Rechtsberatung an die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, Abteilung Recht und Sozialrecht wenden (www.hwk-wiesbaden.de, Tel.: 0611 136-0)

Beratung für Arbeitgeber und Betriebsräte
Der erste Schritt zur eigenen individuellen Lösung: Machen Sie den Online-Selbstcheck und erfahren wie gut Ihr aktuelles Arbeitszeitmodell ist und ob Handlungsbedarf besteht.